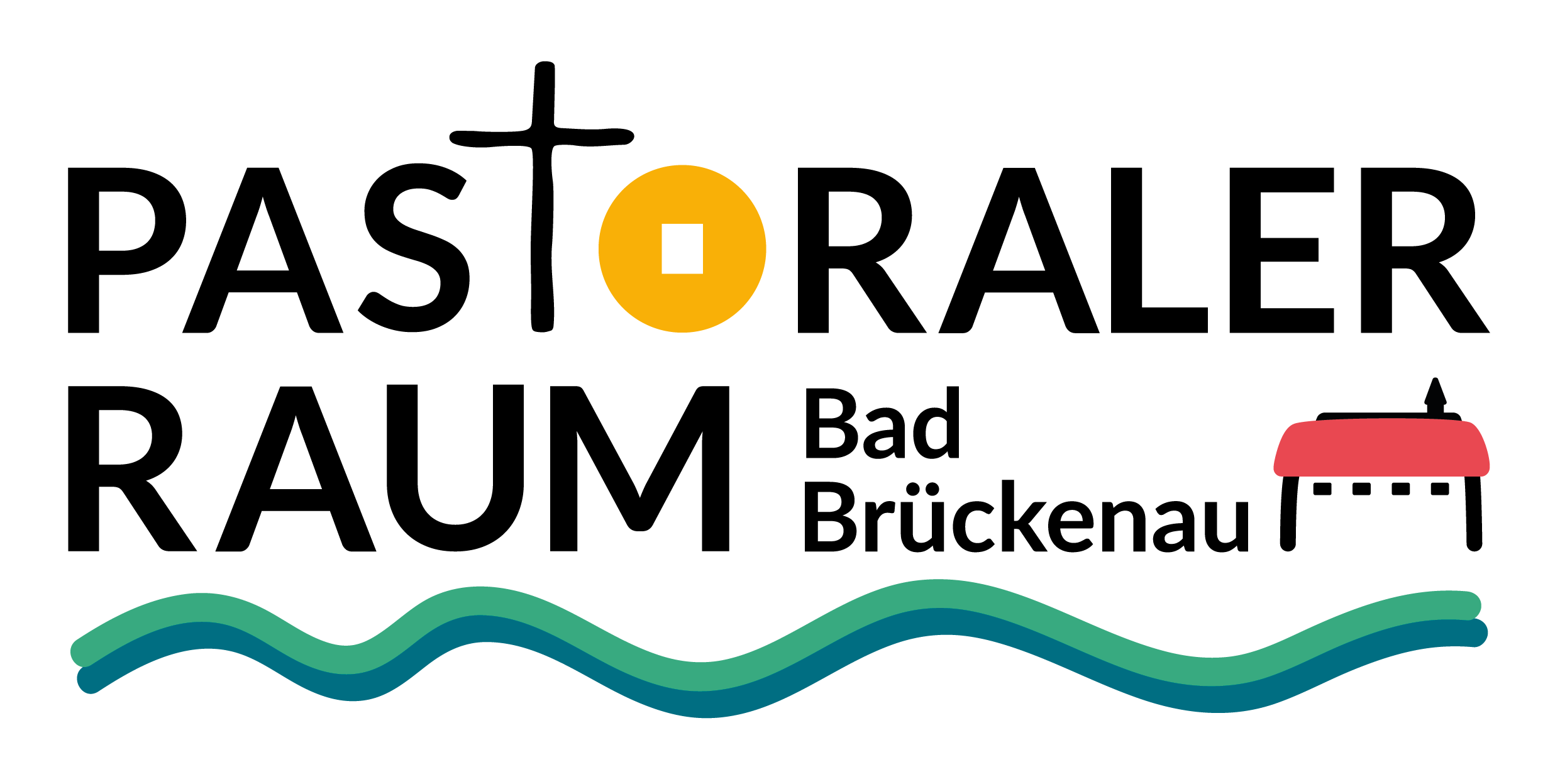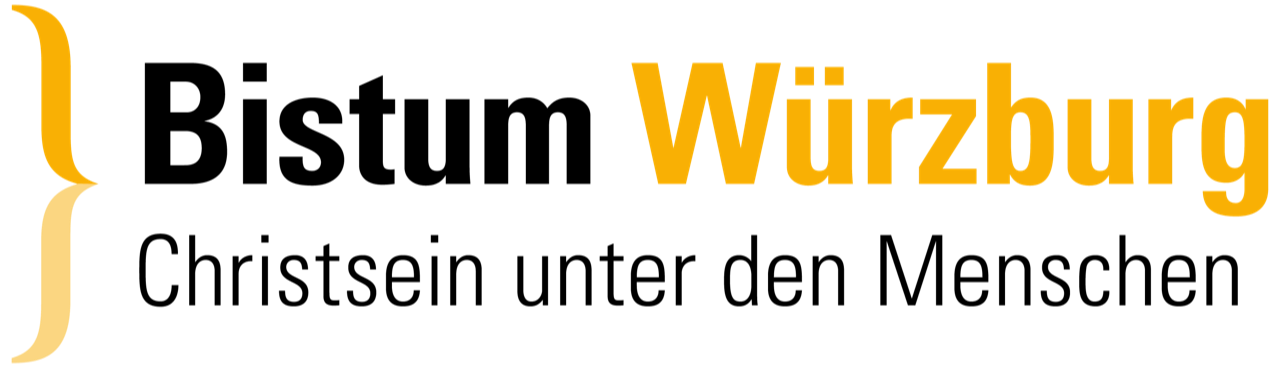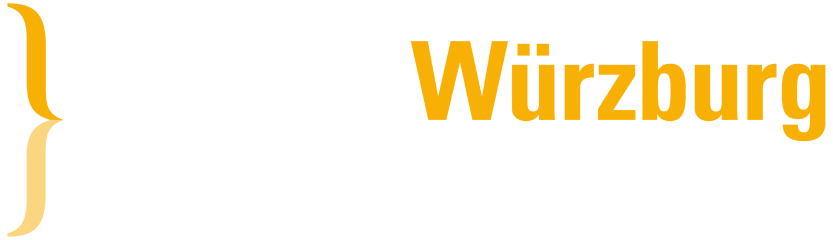Der Wolf kehrt zurück – und mit ihm die Frage nach unserem Verhältnis zur Natur
Seit einigen Jahren sorgt der Wolf in unserer Region immer wieder für Aufregung. Wenn Nutztiere zu Schaden kommen, kochen die Emotionen hoch. Es fallen Worte wie „Abschuss“ oder „Gefahr für Leib und Leben“. Natürlich gehört zu einer sachlichen Debatte, über Herdenschutz, Entschädigungen und notfalls auch Abschussgenehmigungen zu sprechen. Doch rechtfertigt das eine pauschale Dämonisierung eines Tieres, über dessen Rückkehr wir uns eigentlich auch freuen könnten?
Unsere Angst vor dem Wolf sitzt tief. Schon als Kinder begegnen wir ihm als „bösem Wolf“ im Märchen, auch die Bibel kennt ihn meist als Sinnbild der Bedrohung – etwa als „Wolf im Schafspelz“. Solche Bilder prägten über Jahrhunderte unser Denken und trugen dazu bei, dass sich selbst die Kirche an der Ausrottung von Raubtieren beteiligte.
Dabei widerspricht diese Haltung einer zentralen biblischen Überzeugung, wie sie in den Schöpfungsberichten zum Ausdruck kommt: Die Schöpfung ist gut – jedes Geschöpf hat darin seinen Platz und spielt im Gesamtsystem eine wichtige Rolle – auch der Wolf. Der Mensch trägt die Verantwortung, diese gute Schöpfung Gottes zu bewahren, nicht sie zu zerstören.
Ein eindrucksvolles Gegenbild bietet Franz von Assisi. In der Legende vom Wolf von Gubbio verbreitet ein Wolf Schrecken, doch Franziskus begegnet ihm nicht mit Gewalt, sondern mit Vertrauen. Er spricht mit ihm – und schließt Frieden: Die Menschen versorgen den Wolf, der im Gegenzug Stadt und Vieh verschont. Diese Geschichte ist mehr als eine fromme Erzählung. Sie zeigt, dass Versöhnung möglich ist – mit der Schöpfung und mit dem, was uns fremd oder bedrohlich erscheint.
Der Wolf steht auch symbolisch für unsere „inneren Wölfe“ – jene dunklen Seiten in uns, die wir lieber verdrängen. Doch wer sie unterdrückt, riskiert, dass sie umso stärker zurückkehren. Wachstum geschieht erst, wenn wir sie annehmen und Frieden mit ihnen schließen.
Was können wir daraus lernen – für uns selbst und für den echten Wolf in unseren Wäldern?
Erstens: Der Wolf ist da – und er kann zur Gefahr werden.
Zweitens: Gewalt ist keine Lösung. Töten oder Vertreiben beseitigt nicht den tieferliegenden Konflikt – weder in uns selbst noch zwischen Mensch und Natur.
Drittens: Der Wolf erinnert uns daran, dass auch das Wilde, Ungezähmte und Unzivilisierte ein Recht auf Leben hat – selbst wenn es unseren Vorstellungen widerspricht.
Interessanterweise benutzt die Bibel für die Vollendung der Welt am Ende der Tage ein Bild, in dem wiederum der Wolf vorkommt: : „Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten.“ (Jes 11,6) Diese Worte sind nicht wörtlich gemeint, aber sie zeigen eine Vision: eine Welt, in der alle Geschöpfe Gottes ihren Platz haben, in der ein ausgewogenes Miteinander zwischen Geben und Nehmen existiert und der Mensch sich nicht zur Krone der Schöpfung aufschwingt.
Ein Blick in die Nachrichten zeigt: Von diesem Ideal sind wir noch weit entfernt. Doch vielleicht beginnt diese Vision dort, wo wir lernen, den Wolf nicht mehr als Feind zu sehen, sondern als Mitgeschöpf Gottes.
Jens Hausdörfer, Pastoralreferent und Geistlicher Begleiter Haus Volkersberg